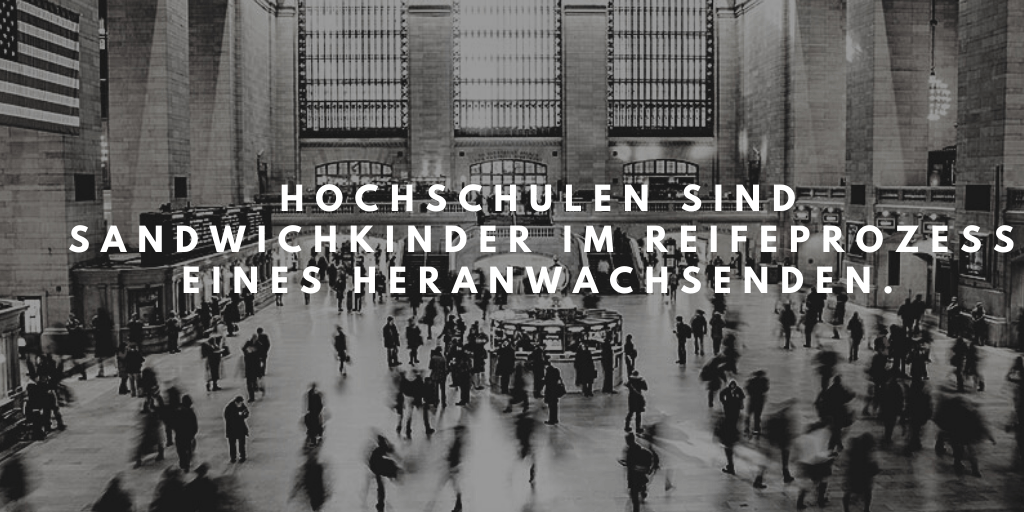Warum die Luft für Hochschulkämpfe zwischen Bologna, Ämtern und Selbstfindung knapp wird.

Es braucht nicht viel, um festzustellen, dass universitäre Kämpfe weit entfernt von einem Vorbild der 68 Jahre sind. Hier liegt vermutlich die erste Synapsenkopplung verborgen, wenn wir über „Kämpfe“ und „Hochschule“ nachdenken wollen. Hochpolitisch, unüberhörbar, unübersehbar und solidarisch – so das Ideal einer Bewegung von jungen, hochgebildeten Menschen, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen wollen und stattdessen für einen Wandel mobilisieren. Jetzt aber ist 2019, 51 Jahre sind seitdem vergangen und bei einem Blick in die deutsche Hochschullandschaft bleibt das alles nur ein Wermutstropfen auf einem Polaroid vergangener Zeiten.
Dennoch haben uns die jüngsten Ereignisse gezeigt, dass wir Ungleichheiten und Missstände nicht verschlafen oder übersehen haben. Dort waren 240.000 Menschen bei der #unteilbar- Demonstration in Berlin, 60.000 Menschen, die Flagge beim #wirsindmehr-Protest in Chemnitz zeigten, Student*Innen die in Potsdam für den Erhalt ihrer Räumlichkeiten kämpften, jene, die sich am Hellersdorfer Campus für Kulturvielfalt engagierten und Student*Innen aus Kassel, die mit Regenbogenwaffeln bei einem Picknick gegen Homo- und Trans*Feindlichkeit protestierten.
Was ist also passiert?

Hochschulen sind Sandwichkinder im Rahmen des Reifeprozesses eines Heranwachsenden, gefangen zwischen einem starren Bildungssystem der Schule auf der einen und einem stark anforderungsorientierten Arbeitsmarkt auf der anderen Seite. Und sowohl die bereits ausgetrocknete Sandwichscheibe von unten (unser Schulsystem hat sich immerhin seit der Weimarer Republik nicht großartig erschüttern lassen), wie auch die durchtriefte Scheibe von oben, nähren den Boden der Hochschule. Und als wäre das nicht ausreichend, stehen wir in der Mitte des Sandwiches auch noch selbst vor vielfältigen persönlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Student*Innen stehen während ihres Studiums nicht nur in der vermeintlichen Blüte und der „besten Zeit ihres Lebens“, sondern auch davor, sie selbst zu werden, sich in der eigenen Persönlichkeit zu festigen.
Die Bologna-Reform führte letzten Endes zu einer Anpassung des Hochschulsystems an das der Schule. Straffe Stundenpläne und oftmals wenig Wahlmöglichkeiten sehen sich dem Wunsch nach der Ausbildung von frei denkenden und ständig reflektierenden Jungspunden ausgesetzt. Die Hoffnung, das jahrelange Bulimie-Lernen hinter sich lassen zu können, findet ihr Grab auf dem Friedhof der selbstständig denkenden „Hochschüler*Innen“, was vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen vielleicht auch eine passendere Bezeichnung für die „moderne“ Idee von Student*Innen ist. Wissenschaft und das Begreifen der Welt voller wissenschaftlicher Entdeckungsmöglichkeiten, genauso wie das Liebenlernen theoretischer Erkenntnisse und ihrer Entstehungen braucht in erster Linie Zeit und Hingabe – deren Räume aber zwischen Studienplatzkampf, Creditpunktsammlung und Notendruck immer kleiner werden. Wichtig geworden ist vor allem eins: das alles möglichst reibungslos und ohne Komplikationen funktioniert.
Für den Großteil der Student*Innen bildet das Studium nur einen Ausschnitt des täglichen Lebens und seltener den Mittelpunkt. Denn oftmals sind die Leistungen des Sozialsystems, in diesem Falle zumeist des BaföGs, nicht ausreichend, um unbedroht das eigene Leben bestreiten zu können. Also braucht es nach intensiven Vorlesungen und einem Stapel von Anträgen die ausgefüllt werden müssen noch einen Nebenjob. Natürlich trägt gerade in Berlin und anderen Ballungszentren der brisante Wohnungsmarkt zu einer Zuspitzung dieser Lage bei. Luxus und Studium sind bei weitem zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen und irgendwie auch nicht zusammengehören. Dass wir hierbei aber nicht über Luxus, sondern vielmehr um Existenzängste reden, führt dazu, dass die Kämpfe der Hochschule vor allem erst einmal an der eigenen Front gewonnen werden müssen. Diese Tatsache entzieht einer aktiven Hinwendung zu gesellschaftskritischen Auseinandersetzungen wahrhaftig die Basis auf der sie entstehen kann.
Der große Gewinner, der sich selbst aber natürlich in einer desolaten Lage sieht, steht derweil am anderen Ende der Hochschule, am Ausgang eines Karussells, dass seine Romantik für ökonomische Interessen in der Realität aufopfern musste und nur noch in den Illusionen unbefleckter Schüler*Innen weiterexistiert. Der Arbeitsmarkt kann es kaum erwarten für ihn zurechtgeschnittene Arbeitskräfte zu gewinnen. Optimiert genug sind die heutigen Student*Innen allerdings immer noch nicht, weisen sie doch kurz nach dem Abschluss in den seltensten Fällen akademische Titel und langjährige Berufserfahrung vor. Dafür aber sind sie hinreizend anpassungsfähig und kompetent darin, Anweisungen und festgelegten Strukturen zu folgen. Als Ergebnis eines langjährigen Systems hierarchischer Unterordnung und oberflächlichem Themen-Abhaken in reflexionsarmen Dimensionen statt intensiven Auseinandersetzungen eine Elite von Beantworter*Innen global-relevanter Fragen und Befeuer*Innen eben solcher Diskurse zu erwarten endet in nicht mehr als Sarkasmus.
Nichtsdestotrotz haben all jene Kämpfe, die im Kontext Hochschule verortet sind, nicht an Bedeutung verloren. Gemeint sind damit Kämpfe, die wir sowohl für uns als Individuum selbst, aber auch für die Gemeinschaft austragen müssen. Diese zielen auf die Verbesserungen und Ressourcen unserer unterschiedlichsten Rollen ab. Es geht um Lebens-, Bildungs- und Arbeitsbedingungen als Student*In, als Mutter oder Vater, als Arbeitnehmer*In, als Verbündete, als Mitglied der Gesellschaft und Zukunftsgestalter*Innen. Der Status von Student*Innen bringt sowohl Rechte, als auch Pflichten mit sich. Kämpfe lassen sich in beiden dieser Pole einordnen. Es ist folglich wenig hilfreich, sich den häufig auftürmenden Veränderungen und Anforderungen zu unterwerfen. Lieber sollten wir uns wieder stärker verdeutlichen, welche Konflikte wir bereits bestreiten konnten, daraus einen notwendigen Optimismus ableiten und uns auf neue Gefechte einstimmen.
Das Wort des Kampfes an sich scheint auf kräftezehrende Auseinandersetzungen körperlicher oder geistiger Natur fokussiert zu sein – obwohl sie doch auf unterschiedlichste Arten und Weisen geführt werden können. Vielleicht ist es manchmal die energiegeladene Ausstrahlung des reinen Wortes, die uns davon abhält Kämpfe einzugehen. Umso schöner, wenn wir von Beispielen lesen in denen das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden werden kann. Unsere Ritterrüstungen und die Molotowcocktails können wir oftmals zu Hause lassen und stattdessen auf Gespräche, Picknickkörbe, Debatten und zielgerichtete Veranstaltungen zurückgreifen.

Gleichzeitig müssen die akribisch eingebläuten Ziele einer auf ökonomische Interessen ausgerichteten Bildung wieder stärker hinterfragt werden. Dies gelingt jedoch nur, wenn, um es mit Karl Marx Worten zu sagen, nicht die „herrschende Klasse“ die Einflusshoheit auf das hiesige (Bildungs-)System zugesprochen bekommt und Wettkampf mit der Immatrikulation und der Einrichtung von wissenschaftlichen Zentren und Lehrstühlen endet. Vielmehr sind hier auch die Hochschulen gemeinsam mit ihren Student*Innen in der Verantwortung, sich auf die eigentliche gesellschaftliche Funktion und die Gestalt ihrer Rolle zurückzubesinnen. Dafür braucht es sowohl sichere Rahmenbedingungen, als auch Freiräume für Freidenker*Innen. Kampf und gesellschaftliche Verantwortung lässt sich nicht auf vorlesungsfreie Zeiten oder Pausen zwischen den Lerneinheiten minimieren. Lehrkräfte müssen Anreize und Räume anbieten, in denen Reflexion und tiefgehende Diskussionen stattfinden können.
Es liegt an uns selbst, auf welche Art und Weise wir die Zeit des Studiums begreifen wollen – als persönlichen Reifeprozess, in dem wir uns einer Epoche von Blicken über den Tellerrand verschreiben, um an den Punkten weiter nachzufragen und zu diskutieren, an denen andere verzagen. Oder aber als bloßen To-Do-Punkt einer Liste, die möglichst schnell zu automatisierten Kräften des Arbeitsmarktes führen soll. Wir müssen uns fragen, für wen wir Hochschule mit Leben füllen wollen, wenn nicht für uns selbst. Hochschule für uns oder Hochschule für sie?
Auseinandersetzungen mit Kämpfen gehen mit Gedanken über Macht- und Ohnmachtsverhältnisse einher. Möglichenfalls haben wir zwischen all den Umbrüchen und dem Trubel der letzten 51 Jahre vergessen, wie viel Macht tatsächlich in, um und an der Hochschule einer Studentenschaft zur Verfügung steht. Und vielleicht ist genau jetzt die Zeit, das eingestaubte Bild der Hochschulproteste in den Frühjahrsputz zu schicken, um gemeinsam Lösungen für Probleme zu entwickeln, die wir selber entdecken und erforschen dürfen.
Substanziell aber brauchen wir zwischen all diesen Widrigkeiten und Fronten eines: einen langen Atem.